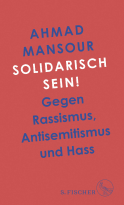
Im Gespräch mit Ahmad Mansour
Mit seinem Buch »Solidarisch sein!« richtet Ahmad Mansour einen Appell an uns alle, unser eingestaubtes Schubladendenken einer Inventur zu unterziehen und darin Platz zu machen für mehr Empathie und Zivilcourage.

Der rassistische Anschlag in Hanau war für Sie der Auslöser, dieses Buch zu schreiben. Wie entsteht überhaupt Rassismus, warum kommt es immer wieder zu Anschlägen?
Rassismus ist ein Gefühl, etwas was in unserem Denken sehr verankert ist. Es hat mit unserer Art und Weise zu tun, wie wir denken, wie wir Sachen wahrnehmen, wie unser Gehirn funktioniert. Es geht um Kategorisierung, es geht um Schubladendenken und davon sind alle betroffen. Und vielleicht war das auch mal sehr gut. Es hat uns geholfen, die Welt besser zu verstehen, auf unsere Feinde besser zu reagieren. Ein Problem ist es, wenn diese Schubladen mit gewissen negativen Eigenschaften verbunden sind und diese wiederum eine negative Emotionalität schaffen und zu diskriminierendem Verhalten führen. Das hat mit Erziehung zu tun, das hat mit Begegnung zu tun, das hat mit Empathie zu tun. Und da sind wir eigentlich schon bei der zweiten Frage.
Anschläge sind nicht nur ein Produkt von Rassismus, sondern es muss noch etwas dazu kommen: Hass. Hass ist ein sehr starkes negatives Gefühl, verbunden mit einer gewissen Persönlichkeit. Vor allem merken wir, dass viele Terroristen gewisse narzisstische, machiavellistische, manchmal sogar psychopathische Persönlichkeitsstrukturen mitbringen. Und diese Mischung aus rassistischen Weltbildern, Hass, der sich daraus entwickelt, und solchen Persönlichkeiten kann zu einem sehr großen Gewaltpotenzial führen. Das sehen wir immer wieder bei allen möglichen Anschlägen.
Was sagen Sie als Psychologe, wie wir Rassismus begegnen können und sollen?
Es gibt nur eine Möglichkeit, Rassismus abzubauen und das ist Begegnung. Wenn ich mein Gegenüber kenne und individuell wahrnehme, dann werde ich ihn nicht in eine Schublade stecken können. Ich merke dann, dass er nicht Mitglied einer Gruppe, sondern vielmehr ein Individuum mit ihm eigenen Gefühlen und Gedanken ist.
Sie haben Ihr Buch allen Pädagogen und Sozialarbeitern gewidmet. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ich arbeite im Alltag viel mit Pädagogen und Sozialarbeitern in Schulen, in Willkommensklassen, in Asylheimen, in Jugendzentren, und ich merke, dass diese Menschen eigentlich diejenigen sind, die die Möglichkeit haben, etwas zu ändern in unserer Gesellschaft und für unsere Zukunft. Sie können unsere Kinder und Jugendlichen für Demokratie, für Menschenrechte gewinnen. Und ich glaube, dass sie sehr oft im Stich gelassen werden von der Politik, die nicht verstanden hat, dass in einer vielfältigen Gesellschaft ganz andere Voraussetzungen und Herausforderungen bestehen. Diese Menschen brauchen Unterstützung. Sie brauchen andere Ausbildungen, andere Schulen. Ich stehe auf der Seite der Pädagogen und Sozialarbeiter. Ich fordere von ihnen sehr viel, aber ich erwarte auch, dass die Politik sie unterstützt und dabei hilft, ihre Aufgaben bestmöglich zu bewältigen.
Was können darüber hinaus Eltern tun, um bei ihren Kindern erst gar keinen Hass auf andere entstehen zu lassen?
Unsere Kinder lernen durch Vorbilder. Das heißt sie beobachten nicht, was wir sagen, sondern was wir tun, wie wir anderen Menschen begegnen. Wenn sie merken, dass wir rassistisch gegenüber bestimmten Menschen sind oder Hassgefühle entwickeln, dann lernen und übernehmen sie das. Und die zweite Sache, die enorm wichtig ist, ist Empathie. Empathie ist für die Erziehung und für die Entwicklung von Kindern enorm wichtig. Und das muss gelernt werden. Eltern müssen, genauso wie Erzieher und Lehrer auch, die Empathie-Entwicklung von Kindern als zentrale Aufgabe in der Erziehung sehen und thematisieren.
Der Anschlag auf die Synagoge in Halle hat sich gerade gejährt. Es gab Gedenkveranstaltungen, Schweigeminuten, Gebete. Sie fordern eine Solidarität, die über Mahnwachen und Sonntagsreden hinausgeht. Was meinen Sie damit?
Die Juden in Deutschland brauchen nicht mehr Sonntagsreden und Solidarität von uns, sie brauchen Schutz. Sie brauchen Konzepte und zwar durchdachte, nachhaltige Konzepte, damit solche Anschläge sich nicht wiederholen, damit Antisemitismus zurückgeht. Das sehe ich in dieser Gesellschaft nicht. Ich sehe, dass wir viel Symbolpolitik betreiben. Aber ich sehe die Konzepte nicht in den Schulen, ich sehe die Konzepte nicht in den sozialen Medien, ich sehe die Konzepte nicht beim Umgang mit Israel. Ich fordere ein Umdenken und eine Politik, die Verantwortung übernimmt.
Sie sprechen von der beeindruckenden Solidarität, die so viele Menschen in der Coronakrise aufbringen. Inwiefern können wir diese als Vorbild nehmen, wenn es um Rassismus oder Antisemitismus geht?
Natürlich ist das unser Vorbild. Das ist eine der Situationen, in denen wir Zusammenhalt gespürt haben. Menschen haben nicht nur an sich gedacht, sondern auch an die Anderen, an die Schwächeren, an die Betroffenen. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen eine Zivilgesellschaft mit ganz viel Zivilcourage. Die füreinander da ist, die ein Wir-Gefühl hat und nicht sieht »das sind die Juden«, »das sind die Ausländer«, »das sind die Deutschen«, sondern wir alle sind eins. Wir sind Deutschland, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir sind Demokraten. Und Demokratie ist nur möglich, wenn Minderheiten geschützt werden. Natürlich müssen wir uns dabei auf Werte einigen.
Sie sind in Israel aufgewachsen und haben Ihre Heimat 2004 verlassen, unter anderem weil Sie nicht mehr unter der ständigen Angst vor Terroranschlägen leben wollten. Konnten Sie die Angst hinter sich lassen?
Nein, natürlich nicht. Das ist Teil meiner Biographie, das ist ein Teil meiner Erinnerung. Und wenn ich in meiner neuen Heimat immer wieder solche Situationen erlebe, die mich sehr an Israel erinnern, dann ist diese Angst allgegenwärtig.
Am Ende Ihres Buches listen Sie sieben Vorschläge auf, wie wir es schaffen können, solidarisch zu sein. An erster Stelle schlagen Sie einen Gedenktag für die Opfer von Terrorismus vor. Können Sie das näher ausführen?
Wir müssen aufhören, immer nur zu reagieren. Wir müssen weg von diesen kurzfristigen Gedenkveranstaltungen und hin zu einer Gesellschaft, die sich erinnert, einer Gesellschaft, die nicht vergisst, einer Gesellschaft, die zusammenhält, einer Gesellschaft, die für die Opfer da ist. Ich weiß, dass es seit 1945 unterschiedliche Radikalisierungstendenzen in dieser Gesellschaft gab und gibt: Von Linksextremisten, palästinensischen Terroristen, die in Deutschland Juden umgebracht haben, über Rechtsradikale bis hin zu Islamisten. Jede Form von Extremismus ist menschenverachtend. Es darf keine Priorisierung der Opfer unterschiedlich motivierter Anschläge geben. Deshalb brauchen wir einen Tag, an dem wir alle Opfer in den Mittelpunkt stellen. Für sie da sind, ihren Familien Unterstützung anbieten und zeigen, dass Terror nicht dazu führt, dass wir uns spalten, sondern im Gegenteil, dass Terror dazu führt, dass wir zusammenhalten, dass wir für die Opfer da sind und nicht für die Täter.
Das Gespräch führte Ulrike Holler
