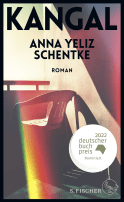
Interview mit Anna Yeliz Schentke zu ihrem Debütroman »Kangal«
»Kangal«, der Debütroman von Anna Yeliz Schentke, erzählt von drei jungen Menschen und einem repressiven System. »Anna Yeliz Schentkes Debütroman nimmt die Leserinnen und Leser gefangen«, sagt Hannah Rau im WDR. Wir haben die Autorin gefragt, wie sie das gemacht hat.

In »Kangal« geht es darum, wie ein Entkommen vor einer repressiven Gesellschaft, vor einem repressiven Staat nicht mehr möglich ist. Wie Bedrohung, Unterdrückung und dieses seltsame Gefühl des Misstrauens und der Unsicherheit in jede Form von Beziehung rinnen. Und auch, wie sich diese Stimmung und das Verhalten der Menschen in ihrer Sprache ausdrücken.
Ein Kangal ist ein türkischer Herdenschutzhund, der sehr selbstständig agiert und seine Herde vor Wölfen beschützt
Ganz zu Beginn des Schreibens wusste ich das selbst nicht. Mit etwas Abstand habe ich gemerkt, dass die Figuren erst, als sie Namen bekommen haben, identifizierbar geworden sind. Sie haben dadurch immer mehr Konturen bekommen – das, was sie sagen oder denken, ist nicht mehr geschützt von einer Anonymität. Und das war auch beim Schreiben der Widerstand: dass ich sie in gewisser Weise keiner Öffentlichkeit aussetzen wollte, oder vielleicht vor einer Sichtbarkeit schützen wollte. Das Namengeben hat sich am Anfang fast ein bisschen wie ein Verrat angefühlt.
Die Figuren sind mit dem Schreiben erst richtig klar geworden. Eine Erfahrung, die ich besonders faszinierend fand, war, dass sie, als sie Namen bekamen, in manchen Momenten fast ein eigenes Leben entwickelt haben. Wenn ich mal nicht geschrieben habe, irgendwo unterwegs war und Zeit zum Nachdenken hatte, habe ich mich manchmal dabei ertappt, wie ich mich gefragt habe, was Tekin vielleicht gerade in Istanbul macht. Also im Denken war zu allen Figuren eine ziemliche Nähe da, die dann durch die Arbeit am Text und durch das Schreiben wiederum durch die dadurch aufkommende Distanz unheimlich viel Kontur bekommen haben.
Vielleicht kann Schreiben ein Versuch einer Distanznahme sein. Aber die Nähe zum Gegenwärtigen ist natürlich immer da – die Aktualität hat auch insofern eine Rolle gespielt, als dass ja ständig wieder irgendwelche Dinge passiert sind – also auch während des Schreibprozesses. Proteste, Festnahmen, Gespräche über Dinge, die passiert sind. Und Haltungen und Positionen können sich natürlich auch verändern. Ich denke, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, als Schreibende damit umzugehen. Mir erschien es nur über die Form des Multiperspektivischen möglich, in der jede Figur auch ihren eigenen (sprachlichen) Umgang mit der Situation finden konnte.
Stereotype vereinfachen, verallgemeinern, fördern Klischees. In Bezug auf Herkunftsgeschichten sind sie fast immer rassistisch und führen bei Menschen, die gemeint sind, aber ganz anders, oder auch genau so, zu Verletzungen. Auf sie anzuspielen oder sie gar zu verwenden in einem literarischen Text wirft für mich immer die Frage auf, wie und warum das getan wird. Aus meiner Sicht ist keine der Figuren klischeehaft oder ein überzeichneter Stereotyp, aber – sie wehren sich dagegen. Oder es wird sichtbar, was diese Zuschreibungen für sie bedeuten, auch wenn sich die Figur darüber noch gar nicht bewusst ist. Es ist halt so, dass Aylas Eltern damit Geld verdient haben. Das gibt es. Gleichzeitig geht es in den Konflikten Aylas mit ihren Eltern auch gerade um die Frage nach dem Umgang mit den Zuschreibungen, denen viele Menschen in Deutschland ausgesetzt sind und auf welche Weise diese ihre Leben beeinflussen.
Es ging mir nicht darum, eine Geschichte zu schreiben, bei der die Figuren, in die man so Einblick erhält, die ‚Guten‘ sind oder sich so verhalten, dass man ihr Handeln jederzeit nachvollziehen kann. Die Freundesgruppe, um die es geht, versteht sich selbst als progressiv, als kritisch, als oppositionell. Da ist es vielleicht auf den ersten Blick angesichts der Situation in der Türkei nicht ungewöhnlich, Gefallen daran zu finden. Vielleicht macht es bei Tekin an dieser Stelle ‚Klick‘ – es wird sichtbar, dass die Figuren in der Vergangenheit unter Umständen ignorant waren, oder sich nur um ihr eigenes Wohl gekümmert haben. Denn Unterdrückung gibt es nicht erst seit dem Putsch. Repression gegen eine Vielzahl von Bevölkerungsgruppen gibt es in der Türkei schon sehr, sehr lange. Sie ist auch heute aktueller als zuvor und wird, finde ich, nicht annähernd ausreichend adressiert.
